Droht deutschen Steuervorteilen für gemeinnützige Servicekörperschaften das Aus?
BFH legt EuGH Fragen zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Servicekörperschaften vor
Ein aktuelles Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs an den Europäischen Gerichtshof vom 22. Mai 2025 (V R 22/23) könnte weitreichende Folgen für gemeinnützige Körperschaften in Deutschland haben. Im Kern geht es darum, ob Steuervergünstigungen für sogenannte Servicekörperschaften als rechtswidrige staatliche Beihilfen gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV einzustufen sind. Eine Bejahung könnte die Unanwendbarkeit von § 57 Abs. 3 AO zur Folge haben.
Hintergrund: Steuerbegünstigungen für Servicekörperschaften
Gemeinnützige Körperschaften in Deutschland genießen umfassende Steuerbefreiungen, darunter von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer, sowie einen ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent. Voraussetzung ist traditionell das sogenannte Unmittelbarkeitserfordernis nach § 57 Abs. 1 S. 1 der Abgabenordnung (AO): Die Körperschaft muss ihre steuerbegünstigten Zwecke selbst verwirklichen.
Das Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) hat diese Regelung erweitert. Mit § 57 Abs. 3 S.1 AO können Körperschaften ihre steuerbegünstigten Zwecke nun auch durch planmäßiges Zusammenwirken mit einer anderen gemeinnützigen Körperschaft verfolgen. Ziel war es, Kooperationen zu erleichtern und die Besteuerung bei der Ausgliederung von Serviceleistungen zu ermäßigen.
Vorgeschichte des Verfahrens
Anlass für die EuGH-Vorlage ist der Fall einer 2022 gegründeten GmbH, die Finanzbuchhaltungsdienstleistungen für eine gemeinnützige Stiftung erbringen sollte. Beide Körperschaften verfolgten laut Satzung dieselben gemeinnützigen Zwecke durch planmäßiges Zusammenwirken.
Das Finanzamt erkannte die Gemeinnützigkeit der GmbH zunächst an, hob dies jedoch später auf, da die Kooperation nicht in der Satzung der Stiftung erwähnt war – ein vom Finanzamt gefordertes „doppeltes Satzungserfordernis“. Das Finanzgericht gab der Klage der GmbH statt, woraufhin das Finanzamt Revision einlegte.
Im Revisionsverfahren bestätigte das Bundesministerium der Finanzen (BMF), dass § 57 Abs. 3 AO nicht bei der Europäischen Kommission notifiziert wurde. Das BMF hält eine Notifizierung für nicht erforderlich, da gemeinnützige Unternehmen aufgrund ihrer rechtlichen und tatsächlichen Unvergleichbarkeit mit anderen Unternehmen beihilfefrei gefördert würden und § 57 Abs. 3 AO das bestehende Gemeinnützigkeitskonzept nicht ändere.
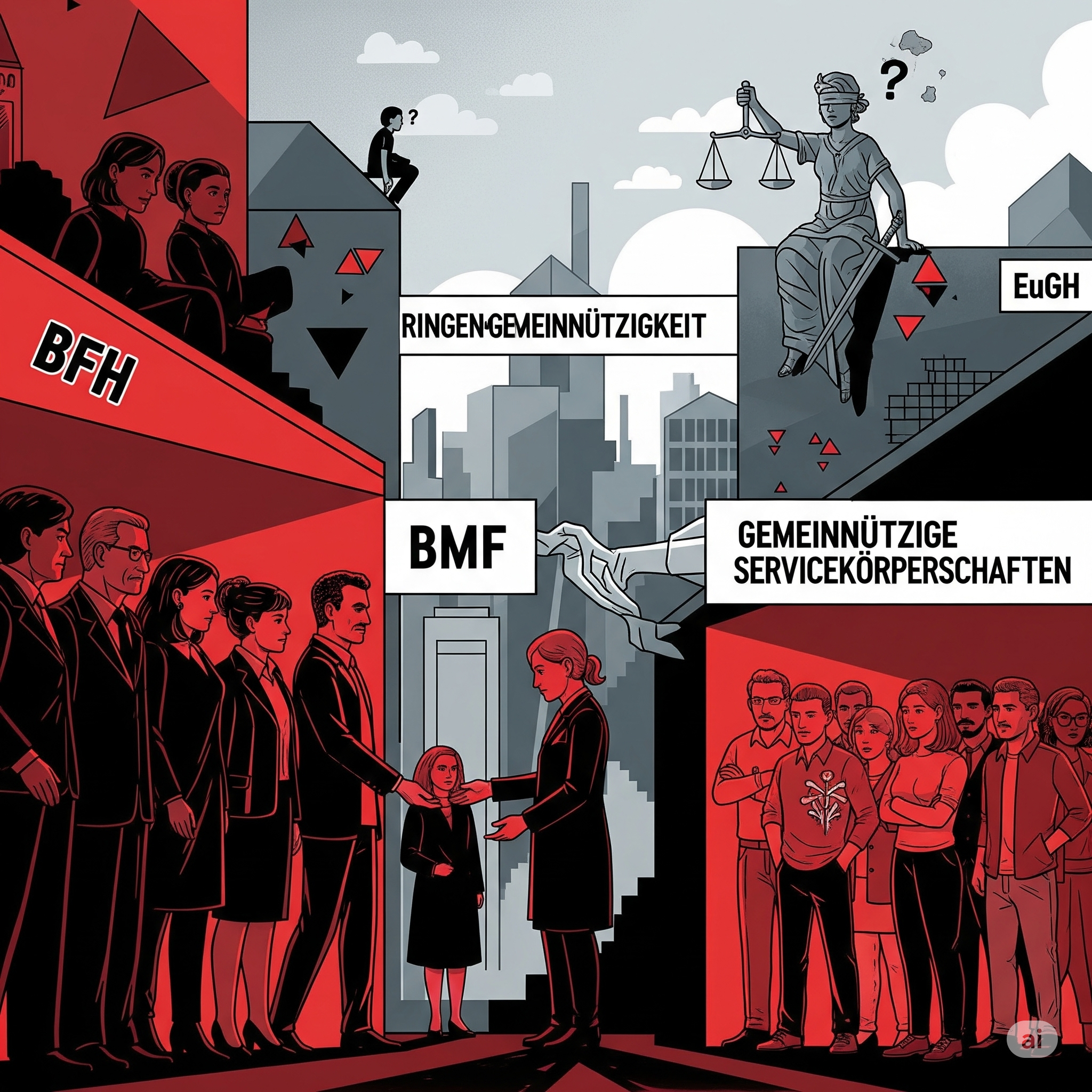
Zentrale Fragestellungen an den EuGH
Der BFH hat das Revisionsverfahren ausgesetzt und dem EuGH drei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
- Beihilfe für Servicekörperschaften? Liegt eine staatliche Beihilfe vor, wenn einer Servicekörperschaft Steuerbegünstigungen für eine wirtschaftliche Tätigkeit zustehen, obwohl sie ihre Zwecke nicht unmittelbar selbst, sondern durch Kooperation verwirklicht und dadurch im Wettbewerb zu nicht begünstigten Anbietern steht?
- Selektiver Vorteil trotz Beschränkungen? Stehen gemeinnützigkeitsrechtliche Beschränkungen (Mittelverwendung, Vermögensbindung) einem selektiven Vorteil entgegen?
- Umgestaltung einer Altbeihilfe? Falls eine Beihilfe bejaht wird: Liegt eine notifizierungspflichtige Umgestaltung einer Beihilfe vor, wenn das nationale Recht eine Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe bereits vor dem 1. Januar 1958 vorsah, der Anwendungsbereich aber danach erweitert wurde?
Die Einschätzung des BFH: Beihilferelevanz gegeben
Der BFH ist der Auffassung, dass § 57 Abs. 3 AO eine Unternehmensbegünstigung (Steuerbefreiungen/-ermäßigungen) durch eine staatliche Maßnahme darstellt. Er sieht zudem eine potenzielle Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedsstaaten und eine Wettbewerbsverfälschung, da Servicekörperschaften „marktgängige“ Leistungen im Wettbewerb anbieten können. Dies gelte auch für Umsatzsteuerermäßigungen, da der deutsche Gesetzgeber hier seinen Ermessensspielraum bei der Umsetzung von EU-Richtlinienrecht überschritten habe.
Hinsichtlich der Selektivität stellt der BFH fest, dass bereits die Begünstigung gemeinnütziger Körperschaften einen selektiven Vorteil darstelle. Unabhängig davon führe § 57 Abs. 3 AO innerhalb der Regelungen für steuerbegünstigte Körperschaften zu einer Ausnahme, die begünstigte und nicht begünstigte Unternehmen trotz vergleichbarer Tätigkeiten unterscheide. Eine Rechtfertigung hierfür sei nicht ersichtlich.
Der BFH hält das EU-Beihilfenrecht ungeachtet des Umstandes für anwendbar, dass die Tätigkeit der gemeinnützigen Körperschaft auch der Allgemeinheit zugute kommt. Die für gemeinnützige Körperschaften geltenden Mittelverwendungsbeschränkungen stünden der Selektivität ebenfalls nicht entgegen, da der erweiterte Katalog gemeinnütziger Zwecke weitreichende Wettbewerbsverzerrungen ermögliche.
Schließlich sei § 57 Abs. 3 AO keine bloße Konkretisierung, sondern eine wesentliche Erweiterung des Begünstigtenkreises. Dies sei entscheidend für die Einordnung als neue oder umgestaltete Beihilfe, die dem Durchführungsverbot des Art. 108 Abs. 3 S. 3 AEUV unterliegen würde.
Ausblick: Weitreichende Implikationen für das Gemeinnützigkeitsrecht
Der Ausgang des Verfahrens vor dem EuGH ist ungewiss, denn die Argumentation des BFH zur Selektivität der Maßnahme ist umstritten. Insbesondere die Bestimmung des relevanten Bezugsrahmens könnte vom EuGH anders bewertet werden, da die Mitgliedsstaaten jedenfalls im Bereich der direkten Steuern Steuerautonomie besitzen, die auch die Schaffung von Steuerbefreiungen für gemeinwohlorientierte Zwecke umfasst. Zudem ist fraglich, ob Körperschaften, die im Zusammenwirken gemeinnützige Zwecke verfolgen, als eine „kohärente Kategorie von begünstigten Unternehmen“ gelten können, oder ob sie sich überhaupt in einer vergleichbaren Situation befinden wie rein gewinnorientierte Unternehmen – angesichts ihrer strengen Mittelverwendungs- und Vermögensbindungsregeln. Möglicherweise ist bei der Beurteilung der Maßnahme auch zwischen ertrags- und umsatzsteuerlichen Folgen zu unterscheiden – dann wäre § 57 Abs. 3 AO aber der falsche Anknüpfungspunkt.
Der EuGH wird im Rahmen des Vorabentscheidungsersuchens Stellung hinsichtlich des unionsrechtlichen Beihilferecht beziehen und dem BFH voraussichtlich Kriterien für seine abschließende Prüfung an die Hand geben. Für gemeinnützige Organisationen in Deutschland bedeutet dies eine Phase der Unsicherheit, auch wenn der Vorlagebeschluss selbst keine Bindungswirkung für die Finanzverwaltung entfaltet. Die Entscheidung des EuGH könnte grundlegende Auswirkungen auf die steuerliche Anerkennung von Servicekörperschaften und das gesamte Gemeinnützigkeitsrecht haben.

