EuGH-Verfahren zu deutschen Steuervorteilen für gemeinnützige Servicekörperschaften (Teil 2): Droht ein Rückabwicklungschaos?
Ein aktuelles Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs (BFH) an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom 22. Mai 2025 (V R 22/23) könnte weitreichende Folgen für gemeinnützige Körperschaften in Deutschland haben. Den Beschluss des BFH haben wir in unserem Beitrag vom 18. Juli 2025 beleuchtet: Im Kern geht es in dem Verfahren darum, ob Steuervergünstigungen für sogenannte Servicekörperschaften als staatliche Beihilfen gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV einzustufen sind, die dann mangels Notifizierung und Genehmigung durch die Europäische Kommission rechtswidrig sind.
Teil 2 der Reihe zu diesem Vorabentscheidungsersuchen beschäftigt sich mit der Frage, ob die gewährten Steuerbegünstigungen zurückzuerstatten wären, wenn der EuGH die Regelung in § 57 Abs. 3 AO als unionsrechtswidrige Beihilfe einstuft. Die Rechtsfolgen sind sowohl aus steuer- als auch aus EU-beihilfenrechtlicher Perspektive zu betrachten.
Deutsches Steuerrecht: Keine nachträgliche Rückforderung von Steuervorteilen bei Aberkennung der Gemeinnützigkeit
Gemäß § 60a Abs. 1 AO wird die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO gesondert festgestellt. Zu den Voraussetzungen gehört die Unmittelbarkeit i. S. von § 57 AO. § 60a Abs. 3 AO bestimmt, dass eine Feststellung ihre Bindungswirkung verliert, sobald sich die zugrunde liegenden gesetzlichen Vorschriften ändern oder aufgehoben werden; einer Entscheidung der Finanzverwaltung bedarf es nicht. Typische Beispiele hierfür sind Änderungen des Gemeinnützigkeitsrechts, etwa eine Anpassung des § 52 AO oder der gesetzlichen Mustersatzung.
Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist gemäß § 60a Abs. 4 AO die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben. Auch insoweit wirkt die Aberkennung der Gemeinnützigkeit mithin nur für die Zukunft („ex nunc“), sodass für die Vergangenheit keine nachteiligen Konsequenzen drohen. Etwas anderes gilt gemäß § 61 Abs. 3 AO, wenn die Bestimmung über die Vermögensbindung nachträglich so geändert wird, dass sie den Anforderungen des § 55 Abs. 1 Nr. 4 AO nicht mehr genügt.
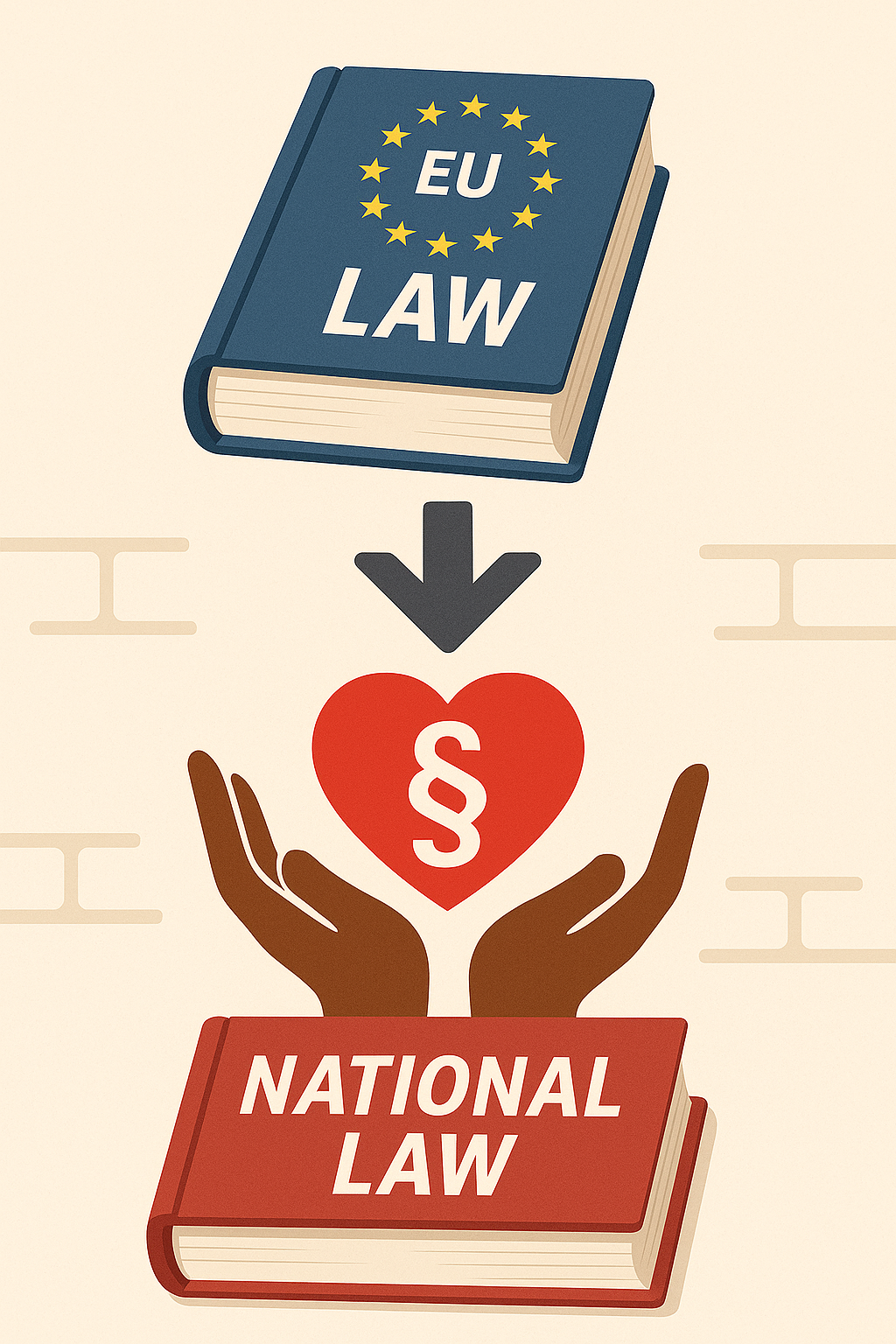
Aber: EU-Beihilfenrecht bricht deutsches Steuerrecht
Die Rechtsfolgen nach dem EU-Beihilfenrecht weichen von denen, die § 61a AO anordnet, wesentlich ab: Stellt eine steuerliche Begünstigung eine staatliche Beihilfe dar und wird diese im Nachhinein als unionsrechtswidrig eingestuft, ist grundsätzlich der Zustand wiederherzustellen, der bestehen würde, wenn die Begünstigung nicht gewährt worden wäre. Das bedeutet, dass die betreffenden Steuerbescheide regelmäßig zu ändern sind und die gewährten Steuervorteile zurückgefordert werden müssen; zudem sind hiermit verbundene Zinsvorteile abzuschöpfen.
Dabei hat das EU-Beihilfenrecht Vorrang vor nationalen steuerrechtlichen Regelungen. Weder die Bestandskraft eines Steuerbescheids noch die Festsetzungsverjährung, die verbindliche Auskunft eines Finanzamts oder die Rechtskraft einer nationalen gerichtlichen Entscheidung stehen einer Rückforderung entgegen. Vertrauensschutz kann sich in diesem Zusammenhang nur aus Zusicherungen der EU-Organe ergeben, nicht jedoch aus Handlungen oder Regelungen des Mitgliedsstaates, der unionsrechtswidrig gehandelt hat.
Die Rückforderung bezieht sich auf den steuerlichen Vorteil, der unmittelbar durch die unionsrechtswidrige Regelung erlangt wurde. Dies dürfte zum einen Vorteile aufgrund von Steuerbefreiungen bei den Ertragsteuern (Körperschaft- und Gewerbesteuer) betreffen. Zum anderen könnte dies auf Vorteile aufgrund von Ermäßigungen bei der Umsatzsteuer anzuwenden sein. Im Falle der Feststellung der Unionsrechtswidrigkeit von § 57 Abs. 3 AO müssten die Finanzämter diese aufgrund der Gemeinnützigkeit erhaltenen steuerlichen (sowie Zins-)Vorteile wahrscheinlich zurückfordern – selbst wenn nationalrechtliche Vorschriften wie § 60a Abs. 3, 4 AO nur eine Wirkung für die Zukunft anordnen.
Grundsätzlich gilt, dass die Europäische Kommission die Rückforderung innerhalb von zehn Jahren seit Gewährung der Beihilfe verlangen kann. Bei Konkurrentenklagen vor den nationalen Gerichten können diese nach der Rechtsprechung des EuGH eine Rückforderung rechtswidriger Beihilfen aber auch anordnen, wenn diese Frist verstrichen ist.
Fazit
Bei der Beurteilung von Rückforderungsansprüchen gegenüber Servicekörperschaften im Fall einer unionsrechtlichen Beanstandung geraten das deutsche Steuerrecht und das EU-Beihilfenrecht in Konflikt – dabei setzt sich das EU-Beihilfenrecht im Ergebnis durch. Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts begründet das Risiko, dass steuerliche Vergünstigungen auch rückwirkend zurückgefordert werden müssen, selbst wenn dies nach deutschem Recht ausgeschlossen wäre. Servicekörperschaften sind damit aktuell einem erheblichen potenziellen Rückforderungsrisiko ausgesetzt, sollte der EuGH § 57 Abs. 3 AO als unionsrechtswidrige Beihilfe einstufen.
Wir danken unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dr. Kira Scholler für Ihre wertvolle Unterstützung bei der Vorbereitung dieses Beitrags.


